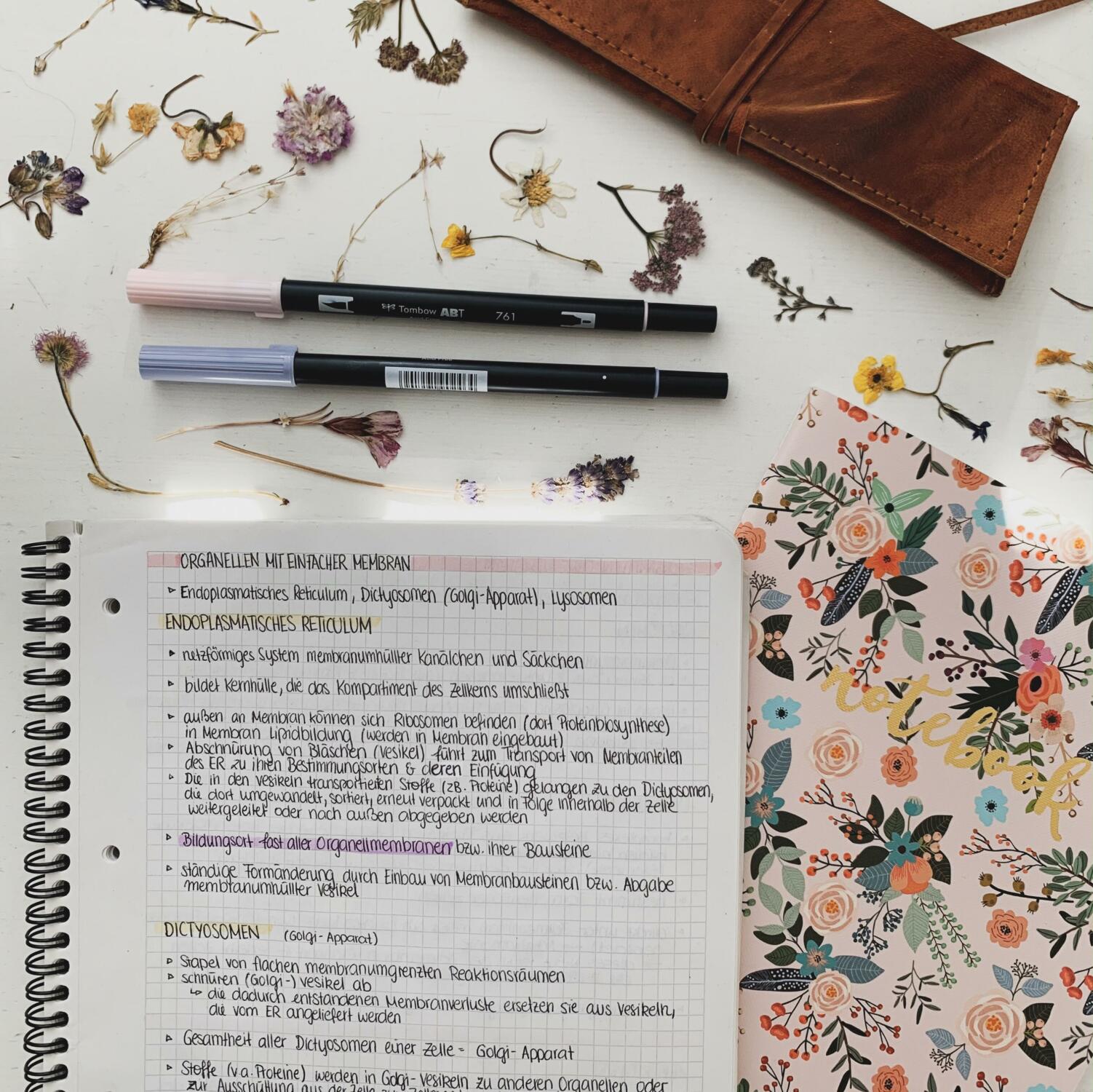
Herzlich willkommen auf Viktorias Blog zum Medizinstudium. Viktoria hatte das Glück mit 87% Rangplatz 60 beim MedAT 2020 in Graz zu erreichen. Medizin studieren möchte sie, um anderen Menschen zu helfen ganz nach dem Motto „Helping people at their most vulnerable time is a privilege.“ Hier auf dieser Seite bekommst du Einblicke in den Alltag, die Gedanken und Erfahrungen von Viktoria an der MedUni Graz. Viel Spaß beim Lesen.

Hey, ich bin Viktoria!
Ich bin 20 Jahre alt und nehme euch auf diesem Blog mit durch die Höhen und Tiefen meines Medizinstudiums an der Medizinischen Universität Graz. Was euch erwartet? Naja, ich kann jetzt schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle, neue Perspektiven sowie Informationen versprechen, die jede:n (ob nun vom Medizinstudium träumend oder nicht), einen spannenden Einblick in den Alltag eines Medizinstudierenden abseits von „Grey’s Anatomy“ und „Scrubs“ geben.
Diese Blogposts wurden bereits veröffentlicht
Hier gelangst du direkt zu Viktorias verschiedenen Blogbeiträgen. Klicke hierfür einfach auf das Bild.

Blogpost #3
Mein Stationspraktikum
Wer bin ich eigentlich?
Obwohl man meinen mag, dass Wörter wie „Freizeit“ oder „Hobbys“ vor allem für eine Medizinstudentin in der Vorklinik Fremdwörter sind, kann ich euch beruhigen. Ein bisschen Luft bleibt neben den Knochen und der Humangenetik doch noch. Und diese freien Minuten verbringe ich als leidenschaftliche Freizeitabenteurerin meist irgendwo im Nirgendwo. Am liebsten in den Bergen, am Meer oder auf Reisen in der Natur verstreut auf der Welt. Ohne jegliche Hoffnung auf Empfang. Mit dabei meist nur mein Rucksack, meine Kamera und ein Buch, in dem ich das Erlebte festhalten kann. Ganz abgesehen davon, dass innerhalb weniger Sekunden schon mehrere hundert Schnappschüsse meine Fotogalerie ausschmücken. Doch sind wir einmal ehrlich: gibt es denn auch irgendetwas Schöneres als Fotos und Videos von Momenten, die man ansonsten wahrscheinlich schon vergessen hätte?
Mit dabei ist meistens meine bessere Hälfte, mein bester Freund. Die Person, bei der Spaß eine neue Dimension annimmt, mit der ich hier und da meine Fähigkeiten als Meisterköchin von Süßkartoffeln beweisen und vor allem meine Liebe zum Tanz ausleben kann. Ob der Muskelkater dann am Ende des Tages vom Sport oder doch vom ganzen Gelächter kommt, wird jedoch in diesem Fall für immer ein Mysterium bleiben.

Doch was mache ich, wenn es einmal ruhig wird? Dann findet man mich am ehesten mit einem Buch am See oder neben meinem Hund am Boden liegend. Meine Devise: Hauptsache immer mit möglichst wenigen Dingen, das Beste aus jeder Situation machen. Ob nun zuhause oder doch lieber am anderen Ende der Welt. Denn wenn ich eines auf meinen Backpacker-Abenteuern und Bergtouren gelernt habe, dann, dass weniger meist wirklich mehr ist.
Dieser Minimalismus spiegelt sich aber weniger in meiner Art wider. Wer mich kennt, würde sagen, dass ich alles kombiniert in einer Person bin. Eine wahre optimistische Realistin mit einem ausgeprägtem Hang zur Träumerei, die übereuphorisch bei jedem Blödsinn dabei ist und ihr Herz auf der Zunge trägt. Für viel zu viel zu begeistern und einfach nicht zu stoppen.
Jedoch auf der anderen Seite eine hochsensible Leidensgenossin, deren Empathie- und Einfühlungsvermögen sie zur Medizin gebracht haben. Wahrscheinlich war dieser Hang zur Hilfsbereitschaft wirklich eine der ausschlaggebenden Punkte neben meiner Faszination über den menschlichen Körper, die dazu geführt haben, dass ich in meiner Freizeit nun Knochenstrukturen studiere. Und ich liebe es. Vor allem, da einem als Mediziner:in so viele Türen offen stehen. Wie ich diese Chance später nutzen will? Ich weiß es noch nicht. Hauptsache ich kann es mit meiner Begeisterung zu komplementären Heilmethoden kombinieren. Denn, glaubt mir, ich trage nicht umsonst in meinem Freundeskreis den Titel der „alternativen Kräuterhexe“.
Doch da alle meine Interessen, liebsten Beschäftigungen und daily struggles den Rahmen sprengen würden, möchte ich mich wirklich kurz halten. Ausnahmsweise. Also bleibe ich dabei, dass ich vieles vereint in einer Person bin. Zu viel, um es in ein paar Sätze zu packen. Aber vor allem bin ich eines; eine Person, mit einer riesengroßen Liebe zur Medizin, die für die Dinge lebt, die sie gerne macht und diese Freude unglaublich gerne mit der Welt teilt.
Ich hoffe, dass ich euch hiermit einen kleinen Einblick in meine Welt geben konnte. In mein konfuses, chaotisches, überfülltes und doch wundervolles Leben. Vielleicht bin ich dadurch keine strukturierte, durchgeplante Normmedizinerin, die schon weiß, wohin ihr Weg führt. Doch ich mag das. Hauptsache, es wird nicht langweilig. Denn normal kann jeder. 🙂
Die erste Woche im Medizinstudium
Der erste Tag als offizielle Medizinstudentin. Ein Tag, auf den ich mich bereits vor dem Beginn meines Humanmedizin-Studiums unglaublich gefreut habe. Ein Haufen junger Menschen, die das Glück haben, den MedAT zu bestanden zu haben, super motiviert auf dem Weg in den riesigen Hörsaal, wo ihnen gleich zu Beginn für ihren Erfolg gratuliert wird. Gelächter, wenn ein scheinbar lustiger Witz erzählt wurde und einheitliches Klopfen auf die – für meinen Geschmack – viel zu kleinen Tische, wenn der oder die Vortragende mit ihrer Vorlesung fertig ist. Der perfekte Beginn in das – für mich – perfekte Studium, von dem so viele angehende MedATler träumen. Und doch muss ich euch enttäuschen: Leider kam nichts so, wie erwartet.
Die Sache mit Corona
Aufgrund der derzeitigen Situation kamen wir nicht in den Genuss dessen, was ich zuvor beschrieben habe. Kein „Endlich ist er fertig“-Blick an den Kommilitonen, der nun einer der Verbündeten zu sein schien. Kein einheitliches Gelächter im Hörsaal. Wobei die ein oder andere witzige Bemerkung zugegebenermaßen trotzdem mit einem Schmunzeln meinerseits vor dem Computer abgetan wurde.
Wie es dann bei uns aussah? Ich für meinen Teil verbrachte den Tag viel zu motiviert in meinem MedUni Graz-Pullover und mit einer Tasse Tee vor dem Bildschirm. So bekam ich zumindest beinahe das Gefühl einer Erstsemestrigen, wie es die Jahre zuvor beschrieben wurde. Plan hatte ich bis am Ende noch keinen und nach fünf Stunden Einführung stellte es sich als sehr schwer heraus, bei der Menge an Informationen, die einem mitgeteilt wurde, nicht einzuschlafen. Spannend klingt anders. Und doch war es der Anfang von etwas ganz Großem, was mein Leben für immer verändern würde. Alleine das machte es bedeutend genug.
Die Einführungswoche
Die Tage darauf wurden nicht ereignisreicher. Die Vormittage verbrachte ich vor meinem Laptop, indem ich mir Vorträge über die verschiedenen medizinischen Fachbereiche anschaute, zuhörte, als über die richtige Kommunikation mit PatientInnen gesprochen wurde und besonders interessiert war, als über unser anstehendes Stationspraktikum erzählt wurde.
Die Nachmittage verbrachte ich dann mit meinen – per Zufall kennengelernten – Kommilitonen, um über die, am Vormittag besprochene, Mülltrennung und den Brandschutz zu reden oder mich mit ihnen gemeinsam auf die anstehenden Tage auf der Uni zu freuen. Kam ich in der ersten Woche dann überhaupt in das Vergnügen der Medizinischen Universität Graz? Ja, natürlich. Wir hatten doch Latein.
Mein erster Tag auf der MedUni
Manche lachten drüber, andere wiederum rollten genervt die Augen. Ich für meinen Teil freute mich. Ich mein, ja, man mag meinen, dass es etwas bizarr ist, jegliche Vorlesungen und Übungen online zu veranstalten, um das Unigeschehen so „coronatauglich“ wie möglich zu machen, jedoch im gleichen Atemzug die Latein-Vorlesungen als Präsenzveranstaltung verpflichtend zu machen.
Wieso ich als Medizinstudentin Latein mache? Für all jene, die in der Schule Latein entfliehen konnten, kommt so die Retourkutsche, da wir als Medizinstudierende Grundkenntnisse in Latein nachweisen müssen. So kamen verhältnismäßig viele direkt in der ersten Woche in den Genuss eines Tages in der Vorklinik. Und obgleich wir in der ersten Vorlesung nur die Grundlagen der lateinischen Sprache durchgegangen sind, war’s schön. Es war schön sich als Medizinstudentin zu fühlen. Es war schön für die Medizin relevante Begriffe zu lernen. Und vor allem war es schön, Mitstudierende zu sehen, mit denen man in den nächsten Jahren durch dick und dünn gehen würde. Einfach das Gefühl von Gemeinschaft zu spüren, das wir in der jetzigen Zeit und im Rahmen der jetzigen Situation so gut wie nie erleben konnten.
Wie lernt man Leute kennen?
Die jetzige Situation macht es einem vielleicht nicht leicht, doch auf jeden Fall nicht unmöglich, ehemalige MedAtler und somit Mitstudierende kennenzulernen. Ich hatte das Glück, im Rahmen eines vorläufigen gemeinsamen Treffens im Augarten (natürlich mit genügend Babyelefanten dazwischen ;)) schon zu Beginn eine für mich mehr als passende Gruppe zu finden, mit der ich auch jetzt noch den Großteil meiner Frei- und auch Lernzeit verbringe. Und in diesem Zuge mein erster Tipp an alle, die mit ihrem Studium beginnen oder auch bereits länger Studierende sind, die Anschluss suchen; sucht euch Leute, mit denen ihr auf einer Wellenlänge seid und mit denen ihr euch versteht. Sprecht Leute auf der Uni an und traut euch, zu Treffen zu gehen, wo ihr bis jetzt noch keinen kennt.
Ich weiß noch, wie ich mich anfangs gefühlt habe. Ich hatte selbst meine Zweifel und Schwierigkeiten, mich einer fremden Gruppe von Personen anzuschließen. Doch hätte ich es nicht getan, hätte ich wahrscheinlich nie die tolle Gruppe kennengelernt, die ich mir jetzt nicht mehr aus meinem Leben wegdenken kann. Also traut euch! Geht mit wandern, wenn jemand auf den Schöckl geht. Traut euch in die Boulderhalle, auch wenn ihr nicht mal wisst, worum es sich bei dem Sport handelt. Und fragt, ob jemand mit euch die Knochenstrukturen wiederholen möchte, wenn ihr ins Gespräch mit einer oder einem Mitleidenden kommt. Es klingt vielleicht banal, doch es gibt nichts Bereichernderes.
Führung durch die MedUni
Abschließend möchte ich noch von einem meiner Highlights der ersten zwei Wochen berichten. Wie jedes Jahr veranstaltete die ÖH Med Uni Graz auch dieses Jahr ihre Universitätsführungen, wo wir – wie es der Name schon verrät – durch die Universität sowie über den ganzen Medizinischen Campus geführt wurden.
Und auch hierbei wieder ein kleiner Tipp am Rande: nehmt an solchen Führungen teil. Es bietet eine wundervolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die sich in den nächsten Jahren durch dieselben Prüfungen kämpfen müssen und sicher nichts dagegen haben, ihr Leid mit einer zweiten oder dritten Person zu teilen. Da ich jedoch schon viele derjenigen kannte, die an der Führung teilgenommen haben, lag mein Fokus hierbei eher auf der Medizinischen Universität und deren Campus.
Und wenn ich eines sagen kann, dann, dass ich begeistert bin. Ich würde zwar lügen, wenn ich sagen würde, dass die MedUni Graz architektonisch mit der Karl-Franzens-Universität mithalten kann. Jedoch ist es ein Gebäude, welches vor allem in Verbindung mit dem direkt nebenanliegenden LKH Graz-Campus, zu einem Ort wird, wo man mit einer ungeheuren Freude und einer riesigen Portion Stolz seine Zeit verbringt. Die Übungsräume begeistern mich durch ihre schlichte Einfachheit, die Vorlesungssäle lassen mich aufgrund ihrer Größe staunen und die Simulationsräume – wie ich sie immer nenne – verschlagen mir durch ihre Realitätsnähe noch immer den Atem.
Um alles in einem Satz zusammenzufassen, würde ich sagen, dass ich begeistert bin und sich spätestens jetzt all die Stunden und Monate, die ich für die Vorbereitung auf den Medizin-Aufnahmetest MedAT gebraucht habe, mehr als ausgezahlt haben. Die Freude darüber, kann ich bis jetzt kaum in Worte fassen.
Mein Fazit
Würde ich abschließend sagen, dass sich die Monate des Lernens im Endeffekt ausgezahlt haben? Ja. Um ehrlich zu sein, gibt es nichts, bei dem ich mir bis jetzt so sicher war. Natürlich merkt man schon langsam, dass der Aufnahmetest noch das Leichteste an all dem war, was mich in den nächsten Jahre erwarten wird. Und natürlich habe ich die letzten Wochen mehr Zeit in der Bibliothek mit Recherche und Zusammenfassungen verbracht als freie Stunden zuhause. Doch ich bereue keine Sekunde davon. In diesem Sinne, möchte ich all jene, die mit dem Gedanken spielen, Medizin zu studieren und den MedAT zu schreiben, dazu ermutigen, das zu tun. Und all jene, welche sich bereits wie ich im ersten oder vielleicht sogar in einem höheren Semestern befinden, virtuell umarmen und schon jetzt eines vorwegnehmen: wir schaffen das.
Mein Stationspraktikum auf der Allgemeinen Chirurgie
“Es war umwerfend. Im wahrsten Sinne des Wortes.” sind die ersten Worte, die mir einfallen, wenn ich an das Stationspraktikum auf der Allgemeinen Chirurgie zurückdenke. Und obwohl sich das nach einer typischen Floskel anhört, sag ich euch eins – es war so umwerfend, dass ich das ein oder andere Mal wirklich selbst den Boden unter den Füßen verlor.
Was ist ein Stationspraktikum überhaupt?
Vor meiner Woche auf der Station der Allgemeinen Chirurgie konnte ich mir auch wenig darunter vorstellen. Zwar hieß es immer, dass man dabei eine Woche im Krankenhaus verbringt, um über den Alltag im LKH zu erfahren, jedoch gab mir das nur eine schwammige Vorstellung darüber, was mich wirklich erwarten würde. Aber lange Rede, kurzer Sinn – was ist es nun? Prinzipiell ist es eine Woche, die man mit einer paar Mitstudierenden auf der jeweils zugeteilten Station verbringt, um einen Einblick in die Arbeit auf der Station zu bekommen. In meinem Fall – einen Einblick in die Arbeit der Pfleger:innen auf der Frauenstation der Allgemeinen Chirurgie.
Und wie kann man sich das genau vorstellen?
Schon der erste Morgen startete bei mir mit einem lauten Weckerklingeln um 5:34 Uhr. Dies lag aber weniger an dem frühen Stationsbeginn, sondern eher daran, dass ich am ersten Tag noch eine Stunde mit dem Bus zum LKH Graz fahren musste. Gestartet sind wir meist um 7:30 Uhr, wo uns immer eine kleine Einführung in den Tag gegeben wurde. Dann ging es zur Frühstücksvergabe und dem anschließenden Waschen der Patientinnen, bei dem wir einen ersten Einblick in die wirklich schwere (und sowas von unterschätzte) Arbeit des Pflegepersonals bekamen.
Richtig spannend wurde es bei den Visiten. Hierbei wurde mir erstmals so richtig bewusst, wie stressig es die Ärzt:innen im Krankenhaus haben. Oft hetzten sie vom einen ins andere Patientenzimmer, nur um schnell wieder in den OP zu kommen, um das nächste Menschenleben zu retten. Umso mehr schätzte ich dann, wie bemüht sie sich dennoch um das Wohl der Patient:innen kümmerten, immer mit einem lustigen Spruch und ihnen das Gefühl gebend, dass sie nicht alleine sind.
Danach folgte mein Lieblingsteil des Tages. Der Teil des Tages, den ich im Laufe der Zeit zu meiden versuchte – der Verbandswechsel. Aber auch der ging vorbei und so verbrachte ich den Großteil der Zeit damit, mit den Betroffenen auf der Station zu sprechen. Über ihr Leben, ihre Krankheit, ihre Sorgen und ihre Familie. Auch die spannendsten Diskussionen über Wellensittiche kamen nicht zu kurz.
Nach der Nachmittagsvisite, die meist so um 14 Uhr stattfand, ging es für uns als Abschluss noch zu den OP-Besprechungen, die besonders spannend waren. Zwar verstand ich vieles nicht, doch irgendwie gaben sie mir das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Teil von etwas Bedeutendem. Und für alle, die sich jetzt fragen, ob die Besprechungen wirklich so sind, wie man es sich vorstellt – ja! Und zwar noch viel besser. 😀
Erwartungen vs. Realität
Ich wurde vor, während und nach dem Stationspraktikum oft danach gefragt, was ich mir erwartete. Ob sich meine Erwartungen erfüllt hatten und wenn nicht, woran das liegt. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde. Doch einfach, da ich keine Erwartungen hatte. Alles, was ich hatte, war etwas Angst. Etwas Nervosität, die ich in meinem ganzen Körper spürte. Und vor allem einen riesigen Haufen Vorfreude, auf das, was mich erwarten würde!
Ich kann mich noch erinnern, wie aufgeregt ich am ersten Tag war. Im beigefarbenen Kittel das erste Mal ins LKH Graz zu gehen. Nicht als Patientin, sondern als Teil des Teams. Dementsprechend nervös war ich auch, etwas falsch zu machen. Doch – keine Bange, keine Panik – wenn ich eines gelernt habe, dann, dass man nichts so wirklich falsch machen kann (weil man eh nicht viel machen darf haha) und dass es keine blöden Fragen gibt. Denn “Wenn du dich etwas wirklich fragst und dadurch etwas dazu lernst, ist die Frage nie blöd”, wie mir unser Stationsleiter immer wieder versuchte, einzutrichtern. Und so löste sich auch diese Angst im Laufe der Zeit wie in Luft auf.
Aber ja – anfangs war die Rolle als Stationspraktikantin auch für mich etwas befremdlich. Nicht etwa, da ich mich nicht darauf freute oder ich gar Angst davor hatte, mit Menschen in Kontakt zu treten. Sondern eher, da ich besorgt war, jemandem zur Last fallen zu können und nicht die Hilfe zu sein, die ich mir wünschte zu sein. Doch es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass sich das anfängliche Unwohlsein wohl am stärksten in meinem Kopf abspielte. Denn auf der Station angekommen, war alles ganz anders, wie befürchtet. Sofort wurden wir zu allen möglichen Aufgaben eingeteilt, von den beschäftigten Pfleger:innen herumgeschickt und nebenbei noch von den neugierigen Patient:innen interviewt. So wurde aus dem Gedanken des „Ich will nicht jedem den ganzen Tag nur im Weg stehen.“ ein „Okay, so entspannend wie alle immer meinen, ist das Stationspraktikum wohl doch nicht.“
Das einzige, wobei ich anfangs kleine Probleme hatte, war das in Kontakt treten mit den Patient:innen. Obwohl ich unglaublich kommunikativ bin, wusste ich einfach nicht, wie ich die ultimativ perfekte Konversation starten sollte und unangenehm war es für mich immer, wenn ich mit meinem beigefarbenen Mantel mit dem Satz „Guten Morgen, ich bin die Viktoria. Medizinstudentin im 1.Semester.“ Klarheit in den Raum bringen musste.
Mit einer anfänglichen Schwierigkeit meine ich hierbei jedoch auch lediglich einen halben Tag der Sorge. Nach dem Frühstück wagte ich mich schon an die erste Patientin, der ich ein Kompliment zu ihrer Haarfarbe machte. Das war der Eisbrecher, der dazu führte, dass ich in den darauffolgenden Tagen wertvolle Ereignisse und Erlebnisse aufnehmen und Gespräche führen durfte, die ich für immer tief in meiner Erinnerung speichern möchte. Daher würde ich nicht nur sagen, dass ich fachlich, sondern vor allem menschlich (ob nun durch die Pfleger:innen, Ärzt:innen oder Patient:innen) einiges für mich, meine Person und mein eigenes Leben gelernt habe.

Gab es auch Momente, die nicht so toll waren?
Definitiv! Dabei fällt mir ironischerweise direkt einer meiner “Highlights” auf der Station ein. Und zwar mein Moment der Bewusstlosigkeit.
Aber beginnen wir einmal ganz am Anfang: wie bereits erwähnt, hatten wir auf unserer Station die Möglichkeit, bei Verbandswechseln dabei zu sein – was an sich ja auch super spannend ist! Doch da wir auf unserer Station zum Großteil mit Tumoren, Amputationen und vor allem septischen Wunden konfrontiert waren, brauche ich keinem zu erzählen, dass es definitiv nichts für schwache Nerven ist. Vor allem, wenn man es mit wenig Schlaf, “Unterzuckerung”, stickiger Luft (die Maske tut einem da wirklich keinen Gefallen) und Dehydration (trinkt viel!!!) kombiniert. Und so bewegte ich mich nach dem Anblick einer stark entzündeten Wunde, die im Zuge einer Zehenamputation entstanden war, langsam aus dem Patientenzimmer, um – im Gang angekommen – dramatisch die Wand runter zu gleiten. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern, da die Stimmen um mich herum mit der Zeit ziemlich dumpf wurden und mir wortwörtlich schwarz vor Augen wurde.
Kurze Zeit später fand ich mich dann jedoch mit hochgelagerten Beinen, einem Glas Wasser und wieder viel zu guter Stimmung lachend auf der Bank des Aufenthaltsraumes liegend. Ein Erlebnis, das für viele verdammt unangenehm gewesen wäre, für mich jedoch wieder eine Geschichte war, die ich mit viel zu viel Humor und ganz ohne Hemmungen herum erzählte.
Was ich euch damit sagen will? Nicht jeder Medizinstudierende hat keine Probleme damit, Unmengen an Blut, Eiter oder entzündeten Wunden zu sehen. Nicht jeder besitzt die Fähigkeit, sich derartig von einem Menschen und dessen körperlichen Beschwerden abgrenzen zu können. “Ich bin die ersten Male immer umgeflogen. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Wenn ihr schon alles könntet, dann müsstet ihr ja auch nicht mehr studieren.” – munterte mich eine unserer Pflegerinnen nach dem Vorfall auf. Ja, für die einen mag das banal klingen. Und für euch freue ich mich. Wirklich. Doch ich weiß auch, dass es auch die Gruppe an Personen gibt, die damit zu kämpfen hat. Die Gruppe an Personen, zu der ich gehöre. Und weil ich weiß, wie ernüchternd das manchmal sein kann, möchte ich euch eines mitgeben: Kopf hoch – das ist alles eine Frage der Zeit und Gewohnheit. Nur nicht aufgeben. We got this.
Was ich abschließend noch sagen möchte?
Obwohl ich jeden Tag emotional und physisch ausgelaugt das LKH Graz verließ, kann ich nicht verleugnen, dass das Strahlen jedes Mal größer wurde. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir die Zeit, die ich dort hatte, zurückgegeben hat. Zum einen begeisterte mich die Kombination aus Kompetenz, Empathie und Witz der Ärzt:innen trotz dem immensen (Zeit-)druck. Zum anderen empfinde ich größte Hochachtung für all das, was die Pfleger:innen Tag für Tag leisten. Denn sie leisten ihre (wirklich) harte Arbeit auf eine Art und Weise, die ich von ganzem Herzen bewundere.
Wem ich dieses Strahlen jedoch zum größten Teil zu verdanken habe, sind die Patient:innen, die ich im Laufe der Woche kennenlernen durfte. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was ich von jeder einzelnen Person gelernt habe und wie bereichernd es war, sie mit ein paar Minuten meiner Zeit so zum Strahlen zu bringen. Und so möchte ich auch diesen Beitrag wieder damit abschließen, jeden von euch dazu zu ermutigen, das zu tun, wofür euer Herz schlägt. Euch zu ermutigen, den MedAT zu schreiben und in die Medizin zu gehen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr damit eure Zeit in der Zukunft verbringen möchtet. Denn spätestens das Strahlen der Menschen gibt einem so viel zurück. So viel, dass ich es gar nicht mehr in Worte fassen kann.
Die Prüfungsphase im Medizinstudium
Durch die warmen Sonnenstrahlen gemütlich um 9 Uhr aufwachen, den ersten Kaffee in der mittlerweile schon strahlenden Sonne genießen und dann langsam an den Berg voll Arbeit machen. Einfach ganz entspannt ein paar Stunden lernen, um nachmittags kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sich seinen Liebsten widmet. Abends geht es ohnehin jeden Abend in eine andere Bar. Ganz zu schweigen von den legendären Studentenpartys, die man bereits taumelnd und laut lachend besucht. Ganz klar. So stellt man sich das typische Studentenleben vor. Ein Leben mit halben Verpflichtungen und noch weniger Sorgen. Doch ich muss dich an diesem Punkt leider enttäuschen – eine solche Vorstellung könnte meiner Realität nicht ferner liegen. Zumindest in den Prüfungsphasen. Da gibt es keine Sonnenstrahlen, die einen aufwecken. Keine Partys, die einem die Sorgen nehmen. Lediglich harte Arbeit, die die Stunden verfliegen und die Zeit in keinerlei Relation mit der Gegenwart bringen lässt.
Mein optimaler Lernalltag
Wie du bereits ahnen wirst – mein Lernalltag sieht anders aus. Meist beginnt er – wenn ich es aus dem Bett schaffe – schon um 6 Uhr morgens. Schnell wird gefrühstückt, geduscht und sich auf den Tag eingestimmt. Physik, Chemie oder doch Knochen? Viel mehr Auswahl habe ich dann auch wieder nicht.
Meist versuche ich die Punkte nach Priorität zu ordnen. Also weniger – was kann ich heute einmal auslassen und mehr, was gehört zuerst erledigt. Wann habe ich die nächste Prüfung? Wofür muss ich zuerst und vor allem mehr lernen? Steht noch ein Arbeitsauftrag an, den ich in meinem Emailchaos übersehen habe? Sicher bin ich mir da, ehrlich gesagt, nie wirklich. Denn trotz meiner vermeintlichen Ordnung verliere ich bei der Menge an Informationen viel zu oft den Überblick.
Wiederholt wird an guten Tagen von 7.30 bis 12.00, um mich am Nachmittag neuen Inhalten zu widmen. Der Lerntag geht dann meist bis 18 Uhr. Wenn viel zu tun ist, dann auch gerne mal bis 20 Uhr. Das hängt aber mehr von meiner Energie als von der tatsächlichen Stoffmenge und somit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand ab. Denn zu tun ist immer was. Immer unglaublich viel sogar. Doch irgendwann ist der Kopf voll und dann geht einfach nichts mehr rein.
Lässt sich das wirklich mit der Realität vereinbaren?
Um ehrlich zu sein – nein. Zumindest den Großteil der Zeit nicht. Derartige Lerntage sind für mich meist eine wünschenswerte Utopie, die nicht so leicht mit einem Leben neben der Uni zu vereinbaren ist. Mit den Verpflichtungen, denen ich nachgehen muss und meinen Hobbys, die ich trotz – oder vielleicht genau wegen der Uni – nicht vernachlässigen möchte. Wirklich freie Minuten fernab aller Uni-Inhalte gibt es in der Praxis momentan wirklich nur selten. Und wenn es sich ergibt, ist auch diese Zeit im Nu wieder bis zum Rand mit anderen Tätigkeiten gefüllt. Im Kopf ist immer was. Sich abends dann einmal ein, zwei Stunden zu nehmen, um abzuschalten, ist daher umso wichtiger. Und die, die nehme ich mir dann auch.
Wofür habe ich die letzten Wochen gelernt?
Ende Jänner stand meine erste mündliche Prüfung an – das Knochenkolloquium. Ich kann mich noch erinnern, wie viel Respekt ich davor hatte. Schon die Wochen zuvor hatte ich mich zielstrebig auf die Prüfung vorbereitet. Jeden Tag Knochenstrukturen von früh bis spät wiederholt. Alleine, mit Kommilitonen und hier und da auch mit meiner Familie. Obwohl letzteres wahrscheinlich weniger Einfluss auf meinen Erfolg hatte, sondern mir lediglich ein gutes Gefühl gab. Warum ich so penetrant für diese Prüfung lernte? Einfach aus Angst, in der Prüfungssituation ahnungslos zu sein. War diese Angst denn am Ende auch begründet? Nein, wirklich nicht. Denn wenn ich eines gelernt habe, dann: Professoren sind auch nur Menschen. Keiner von ihnen möchte dich durchfallen lassen. Und vor allem: in der Theorie ist alles immer viel schlimmer als es in der Realität je sein könnte. Unser Kopf ist einfach so ein verrückter Ort.
Parallel dazu habe ich mich für drei weitere Prüfungen vorbereitet, die auf mich in derselben Woche warteten: die der Pflichttracks Histologie, Chemie und Physik. Lange Rede, kurzer Sinn: im Nachhinein wirklich alles machbar!
Als sei dies nicht schon genug, stand drei Tage später bereits die zweite große Modulprüfung in diesem Semester an: die gefürchtete PM II-Prüfung. Da es sich zeitlich für mich aber unmöglich ausging, verschob ich diese auf Ende Februar. Zwar konnte ich mir somit unmittelbaren Zeitstress ersparen, jedoch musste ich das Opfer bringen, keine Semesterferien zu haben. Was ich zu der Prüfung sagen kann? Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein: sie ist kein Zuckerschlecken, aber sie ist auch definitiv nicht unschaffbar. Ob ich sie geschafft habe, weiß ich jedoch noch nicht. Die Chancen stehen, sagen wir, trotz reichlicher Vorbereitung nur minder gut. Aber alles halb so schlimm – jetzt gönne ich mir einmal meine drei freien Tage!
Und wie geht es mir dabei?
Bei erneutem Lesen meines Blogartikels musste ich etwas schmunzeln. Ich hatte ihn nämlich schon einmal vor einem Monat geschrieben und zwar genau vor dem Knochenkolloquium. Zu diesem Zeitpunkt erschien alles so schwer, so unmöglich. Als wäre das Medizinstudium dazu programmiert, strikt auszusortieren. Denn kein Mensch würde mit so einer Menge an Stress und so vielen Herausforderungen auf lange Sicht umgehen können. In Retrospektive, jetzt nach Absolvierung aller Prüfungen, kann ich euch beruhigen: am Ende ist alles halb so wild.
Ja – das Studium ist fordernd. Es fordert einen geistig, körperlich und mental. Doch ich habe das Gefühl, dass man im Laufe der Zeit damit umzugehen lernt. Vielleicht schätzt man das Studium nicht in den Prüfungsphasen, in denen die ganze Welt sich gegen einen verschworen zu haben scheint. Doch man schätzt es umso mehr, wenn man die Prüfungen hinter sich hat.
Ich kann das Gefühl von innerer Freude und Gelassenheit nicht beschreiben, das ich in den Tagen nach den Prüfungen verspürte. Es ist einfach so schön, zu sehen, was man alles schaffen kann und wie man an seinen Herausforderungen wächst. Wie man lernt, über seine Grenzen hinauszuwachsen. Und wie sehr man es zu schätzen lernt, was man lernen darf. Auch in den Prüfungsphasen habe ich immer wieder versucht, mich daran zu erinnern, wie dankbar ich sein kann und wofür ich all das überhaupt erst mache. Und ich glaube, dass diese Begeisterung und diese Liebe zur Medizin mir die letzten Wochen um einiges erleichtert hat.

Was mir in den letzten Monaten abschließend immer wieder geholfen hat, wenn ich nicht wusste, wo mir der Kopf steht? Ein paar Worte, die ein guter Freund, vor ein paar Wochen mit mir geteilt hat. Er fragte mich, ob ich mich denn als Ärztin sehen würde. Als ich das dann schlagartig bejahte, schmunzelte er. „Dann schaffst du das auch.“
Und weißt du was? Wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch.
Das erste Semester im Medizinstudium
In diesem Artikel möchte ich euch mitnehmen und einen kleinen Einblick in das erste Semester auf der Medizinischen Universität Graz geben. Ein Semester, das es in sich hatte. Und eine Zeit, die trotz Strapazen zu den eindrucksvollsten Zeiten meines Lebens gehört.
Die ersten Wochen
Beginnen wir ganz am Anfang. Ich weiß noch, als ich Anfang Oktober super motiviert ins Semester gestartet bin. Medizinstudentin im 1. Semester. Das Gefühl der Freude kann ich nicht in Worte fassen, auch wenn ich es gerade beim Schreiben wieder erlebe. Es war eine Mischung aus unglaublichem Stolz und einer unglaublichen Vorfreude darauf, was mich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren erwarten würde. Ich war gespannt auf all das, was ich lernen und erleben durfte. Auf die Leute, die ich kennenlernen würde. Und auf die Zeit, die alle als „die beste Zeit ihres Lebens“ betitelten. Und trotz Corona, zeitweisem Stress sowie einem Haufen Verzweiflung kann ich letzteres bestätigen: es ist die beste Zeit meines Lebens.
Aber zurück zum Medizinstudium. Das erste große Ereignis im Studium, was mir einen kleinen Einblick in das bot, was mich in Zukunft erwarten würde, war das Stationspraktikum.
Ich kann mich noch an die Unsicherheit erinnern, die mich überkam, als ich die erste Woche im Krankenhaus verbrachte. Weder hatte ich schon eine Prüfung hinter mir, noch wusste ich, wie man adäquat mit derartigen Situationen umgeht. Wie man mit dem (emotionalen) Stress umgeht, damit, dass man Menschen in einem derartigen Ausmaß leiden sieht. Ich wusste nicht, wie es sein würde, wenn man den ersten Patienten zum Lachen bringt. War nicht darauf vorbereitet, halb zu kollabieren und mir gleich darauf die nächste Wunde ansehen zu müssen. Ich wusste nicht, ob ich den Ansprüchen an eine Medizinstudentin (und später eine Ärztin) gerecht werden konnte. Ob ich nicht zu dumm für all das war. Ich war so viel unsicherer, als ich es jetzt bin.
Doch nach diesem einen Semester stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage, OB ich es hinbekomme, sondern eher WIE und WANN. Ich habe keine Angst vor dem, was kommt. Ich habe Respekt – aber nebenbei verspüre eine riesige Portion Vorfreude. Freude, auf die großartigen Dinge, die einem dieses Studium und der Berufszweig ermöglicht. Auf die Chancen, Möglichkeiten und die Welt, die einem nach diesem Studium offen steht.
Die erste große Modulprüfung PM I
Dann kann ich mich noch genau an die Zeit vor meiner ersten großen Modulprüfung PM I erinnern. Ich hatte den Fehler gemacht, das erste Monat – also den gesamten Oktober – genau nichts für die Uni zu machen. Jede Woche fand man mich entweder auf den Bergen oder mit Kommilitonen lachend am Kochen. Lernen? Davon wollte ich im Oktober nichts wissen.
Jetzt in Retrospektive kann ich sagen, dass ich die Situation damals einfach komplett falsch eingeschätzt hatte. Ich dachte, dass ich mein Leben parallel zum Medizinstudium genauso weiterführen kann, wie bisher. Einfach immer ein bisschen was machen, aber vor allem außerunimäßigen Aktivitäten den Vortritt geben. Ich hatte meine Prioritäten komplett falsch gesetzt und das bekam ich dann auch gegen Ende der Lernphase für PM I zu spüren. Ich wusste noch, was für einen Stress ich hatte.
Einen Tag vor der Prüfung war ich sogar so weit, dass ich gar nicht antreten wollte. Nach einem Telefonat mit einer meiner Kommilitoninnen, ein paar aufmunternden Worten und einen Tritt von mir Selbst in den Hintern wagte ich mich dann aber am Ende doch zur Prüfung. Mit einer Menge Stress und Verunsicherung im Gepäck. Was ich mir danach schwor? Nie mehr so spät zu lernen zu beginnen. Die Zeit besser zu planen und meine Prioritäten zu setzen. Für die Prüfung hat’s am Ende aber gereicht. Durch ein Bauchgefühl, auf das ich mich verlassen konnte und die ein oder anderen Altfragen, die ich bei der Prüfung wiedererkannte, ging sich eine 2 unterm Strich doch noch aus. Was ich dadurch gelernt habe?
- Probieren geht über Studieren: schreib die Prüfung, auch wenn du dich nicht ganz sicher fühlst. Im schlimmsten Fall musst du sie wiederholen, im besten Fall hast du sie hinter dir. Und Prüfungen aufstauen: das ist wirklich nichts.
- Noten und Prüfungsergebnisse sagen nichts über dein Können aus, sondern spiegeln nur deine momentane Leistung bei der Prüfung wider. Also mach dich nicht fertig, wenn mal was schief geht. Man braucht immer ein bisschen Glück.
Ab diesem Zeitpunkt begann ich die Uni ein bisschen ernster zu nehmen…naja, ich nahm es mir zumindest vor. Unterm Strich klappte das anfangs eher schlecht. Aber diesmal weniger aufgrund mangelnden Willens, sondern mehr aufgrund der Tatsache, dass Dezember war und Weihnachten anstatt. Man muss wissen, dass Weihnachten das Event des Jahres für mich ist und ich mich den ganzen Dezember über damit beschäftige, was ich wem schenken und wie ich wem eine Freude bereiten kann. Demnach verflog die Zeit in diesem Monat wie im Flug. Ende des Monats war ich wieder gleich weit wie ein Monat zuvor: Stress des Jahrtausends war angesagt. Denn die erste mündliche Anatomie-Prüfung stand unweigerlich bevor.
Weihnachten mit Skelett und Anki-Wiederholungen
Am 22. Dezember startete ich dann mit dem Lernen. Alles für Weihnachten war getan und nun stand die Uni bevor. Ich weiß noch, wie ich an Heiligabend noch meine Anki-Wiederholungen machte, bevor wir zu Oma fuhren und wie aus den Weihnachtsferien, Ferien wurden, die ich mit Lernen verbrachte. Jeden Tag Knochen für Knochen durch. Ich hatte das Glück, dass eine Studienkollegin ein Skelett zuhause hatte, an dem ich ab sofort jede Woche mit ihr übte. Von früh bis spät gingen wir Knochenstrukturen durch. Denn eine Sache, die noch schlimmer ist als unsicher und unvorbereitet zu einer schriftlichen Prüfung zu gehen, ist, wenn man unvorbereitet und unsicher vor einen Professoren bei der mündlichen Prüfung tritt. Durchfallen will man da schon gar nicht.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ende Jänner habe ich dann auch diese hinter mich gebracht. Trotz Stress. Und trotz Missachtung meines Plans nun strukturierter, vorausschauender und nachhaltiger zu lernen. Man lernt ja bekanntlich immer dazu und definitiv nie aus.
Blöd war, dass parallel zum Knochenkoll die Abschlussprüfungen aller Seminare stattfanden. Histologie, Chemie, Physik. Alles auf einen Haufen, in einer Woche. Drei Tage später sollte dann auch PM II für die ganz Motivierten unter uns stattfinden, zu denen ich – wer hätte es nach meinen letzten Zeilen gedacht – nicht gehörte. Viel lieber tauschte ich den mir zu bekannten Zeitdruck mit etwas mehr Zeit, aber nicht weniger Druck aus. Hört sich sinnvoll an, war es aber nur so halb. Denn so kam ich dieses Jahr nicht in den Genuss von Semesterferien.
Am 25. Februar 2021 war es dann aber so weit: mein erstes Semester war zu Ende. Und wow – trotz Corona, trotz aller Strapazen und trotz dem vermeintlich unspektakulären Semester ist doch einiges passiert. Und das, obwohl ich so vieles nicht einmal erwähnt habe.
Am Ende wird alles gut
Was ich euch abschließend noch mitgeben möchte? Ja, es ist auf jeden Fall nicht immer leicht, schon gar nicht lustig. Doch wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es der ganze Stress wert ist. Wenn ich jetzt auf das Semester zurückblicke, muss ich lächeln. Es war so eine schöne Zeit und ich bin so dankbar, all diese Erfahrungen machen und mit euch teilen zu können.
Wenn ihr gerade an einem Punkt seid, wo ihr nicht wisst, wie’s weitergeht, dann möchte ich euch einen Satz ans Herz legen, der mir in den stressigsten Phasen immer geholfen hat: am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. In diesem Sinne kämpft für eure Träume und lasst euch durch nichts und niemanden – schon gar nicht euch selbst – davon abbringen. Du schaffst das. 🙂
Das zweite Semester im Medizinstudium
Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr lange nicht mit dem Fahrrad gefahren seid? Irgendwie wisst ihr, dass ihr es könnt, aber doch fühlt es sich gleichzeitig so fremd an? So geht es mir heute mit dem Schreiben. Nach wochen-, nein, monatelanger Schreibabstinenz bin ich wieder da. Und das mit mehr Bewusstsein darüber, was ein Medizinstudium ausmacht und von einem abverlangt, als jemals zuvor.
Wo beginnen wir?
Das zweite Semester hat direkt nach einem Wochenende Pause bei mir gestartet. Damals war mir noch nicht bewusst, dass das einfach zu wenig Zeit war, um das erste Semester zu verarbeiten. Denn auch, wenn es in Retrospektive wirklich banal war, hat es für mein erstes Semester als Studierende viel von mir abverlangt. Nichtsdestotrotz startete ich super motiviert ins zweite Semester. Ich mein – die Sezierkurse standen an, der Sommer kam näher und somit auch die Chancen, dass erste Studienjahr gut über die Runden zu bringen. Die Freude und Motivation waren demnach riesig! Vor allem, da man durch Corona im ersten Semester kaum Zeit auf der Uni mit seinen Mitstudierenden verbringen konnte und die Freude, endlich mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können, bei mir mehr als präsent war.
Diese Freude wurde aber schnell wieder vermindert. Im Laufe des Monats bekam ich die Rückmeldung, dass meine Leistungen bei der Prüfung des einen Pflichtmoduls nicht ausreichend waren. Nicht genügend. Für viele wäre das wahrscheinlich kein Malheur gewesen. Natürlich blöd, aber nichts, dass man sich so richtig zu Herzen nehmen würde. Doch für mich war es ein regelrechter Schlag ins Gesicht. Sowas war ich nicht gewohnt. Ich war es nicht gewohnt, dass meine Leistungen schlechter als „Sehr gut“ waren. Ich war nie schlechter als sehr gut. Schon gar nicht und in keinem Fall „Nicht genügend“. Doch so musste ich wohl meine erste negative Erfahrung im Studium machen und lernen, dass Noten nur eine Momentaufnahme deiner Leistungen sind und nicht deine Person sowie deine Leistungen per se definieren. Eine schwere Lektion, mit der ich noch im Laufe des ganzen zweiten Semesters zu kämpfen haben würde.
Mein Highlight im ersten Studienjahr
Doch fokussieren wir uns auf die schönen Dinge. Direkt Anfang Mai startete für mich das Highlight des ganzen ersten Studienjahres: der Sezierkurs. Dieser wurde in einen Gelenkssezierkurs sowie einen Muskelsezierkurs getrennt, wobei zweiterer mein Favorit werden sollte. Ich tue mir schwer, die Faszination, die ich jedes Mal beim Eintritt in den Seziersaal verspürte, in Worte zu fassen. Es war einfach so so so cool! Aber das kann man nur verstehen, wenn man einmal dort gewesen ist. Doch für alle, die nicht die Möglichkeit dazu haben: es ist eine Möglichkeit, den menschlichen Körper auf eine ganz andere, ganz eigene Art und Weise kennenzulernen. Zu verstehen, wie die Muskeln mit den Gelenken zusammenspielen, wie und warum gewisse Körperteile bewegt werden können. Wie unser Gehmechanismus funktioniert und welche Muskeln dafür verantwortlich sind, dass wir greifen können. Ein Weg, Dinge auf viel nachhaltigere Weise zu lernen, alss lediglich aus dem Buch zu pauken. Ich sag’s gerne nochmal: so so so cool!
Parallel dazu liefen die Modulprüfungen PM 3 und PM 4. PM 3 beschäftigte sich hierbei vor mit der Biochemie, während PM 4 die Lehre über den Bewegungsapparat (passend zum Sezierkurs) beinhaltete. Kurze Rede, langer Sinn: PM 4 war mein absolutes Lieblingsmodul! Vielleicht auch einfach, weil mich die menschliche Anatomie unglaublich fasziniert und die Greifbarkeit, die wir durch den Sezierkurs erlangt haben, die aber auch in unserem Alltag immer präsent ist (ist ja quasi wir), mir die Relevanz der Thematik viel näher gebracht haben und ich wusste, wofür ich das lerne. Die Greifbarkeit sowie die Relevanz waren am Ende wohl die zwei Dinge, die mich dazu gebracht, viel faszinierter von all dem zu sein, als ich es mir jemals vorstellen konnte.
Drei Wochen später startete auch der Sezierkurs für das PNS sowie das ZNS. Also das periphere und zentrale Nervensystem, wobei wir uns zuerst die Nervenbahnen außerhalb des Gehirns (PNS) angesehen und danach die, innerhalb des Gehirns liegenden (ZNS) studiert haben. Parallel dazu wieder – klassisch für die MedUni Graz – der Pflichtmodultrack PM 5. Da aber so viel Zeit für den Sezierkurs draufging, konnte man sich nur sehr halbherzig dem Rest von PM 5 widmen. Wirklich schade, wenn man bedenkt, wie spannend das Gehirn und all das, was man dazu lernen kann, ist. Und das, auch wenn das Nervensystem definitiv noch nie zu meinen Lieblingsthemen gehört hat und ich mich auch im späteren Berufsleben wahrscheinlich nicht auf die Neurologie bzw. Neuroanatomie spezialisieren werde. Es löste trotzdem eine Flut an positiven und faszinierten Gefühlen in mir aus. Jedes einzige Mal. Auch wenn die Angst vor den SeKu-Prüfungen mehr als real waren.
Auch in den vermeintlichen Pausen wurde uns nicht langweilig. Famulaturlizenz, die quasi Voraussetzung im Krankenhaus zu arbeiten, Pflichttracks der Biochemie sowie der naturwissenschaftlichen Grundlagen und viele andere Dinge, die wir neben den Sezierkursen und Modulprüfungen hatten, sorgten dafür, dass uns nie langweilig wurde. Aber da es über diese wirklich nicht viel Spannendes zu erzählen gibt, verschone ich euch mit Geschichten und Erzählungen darüber. Denn prinzipiell haben wir dabei zwei verschiedene Dinge gemacht: wir standen im Labor und haben pipettiert und bei der Famulaturlizenz haben wir die praktischen Fähigkeiten, die wir als Famulant*in haben müssen, um auch in der Praxis gebraucht werden zu können, erlernt. Was man sich darunter vorstellen kann? Blutabnahme, Harnkatheter legen, Untersuchungen durchführen, Wundversorge und so weiter und so fort. An sich alles super spannend, da es relevant für die Klinik ist! Aber am Ende doch nur eine Aufzählung an Fertigkeiten, wenn ich darüber schreibe. Wobei die ein oder anderen Momente, wie das erste Mal Blut zu nehmen, schon wirklich einprägsam und toll waren. Ich muss jetzt noch lächeln, wenn ich an meine Freude damals zurückdenke, als ich das erste Blutfläschchen in meiner Hand hielt.
Mein Resümee über das zweite Semester
Und so komm ich zu meinem Resümee über das zweite Semester. Zwar meinte ich am Ende des ersten Semesters schon, dass das alles ein purer Stress und Druck war und dass sich zeitlich nichts ausgeht. Aber es war nichts im Vergleich zum zweiten Semester. Ich will euch wirklich keine Angst machen, doch vor allem die letzten Wochen waren psychisch wirklich oft sehr anstrengend. Der Vorteil? Man lernt dazu und man beginnt sich, auf derartige Situationen einzustellen. Was einem damals viel vorkam, ist auf einmal nicht mehr viel, sondern mehr als schaffbar. Man hat ganz andere Stoffmengen, mit denen man sich rumschlagen muss, doch irgendwie erscheint einem das Meiste nicht mehr so wild.
Was ich also sagen möchte? Ja, die Vorklinik zieht sich und manchmal hat man das Gefühl, dass das alles niemals klappen kann. Doch am Ende muss ich sagen, dass das Meiste ziemlich gut klappt. Und vor allem, dass man aus seinen Fehlern lernt. Ich bin jetzt am Ende meines ersten Studienjahres und ich kann behaupten, unglaublich viel gelernt zu haben. Ich habe viel „falsch“ gemacht bzw. hätte einiges anders machen müssen. Doch am Ende lernt man immer wieder dazu und die Niederlagen zeigen einem so viel auf. So viel, was man noch lernen kann und im Laufe der Zeit auch noch wird. So wie das Leben ist das Studium ein Prozess. Ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Und egal wie tief es einem manchmal vorkommen mag, irgendwann kommt wieder ein Hoch. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz viel Durchhaltevermögen und Kraft. Für den MedAT, fürs Studium oder auch für was auch immer, ihr diese Kraft benötigt. Gerade Wege sind eh langweilig.
Coming soon!
Folge uns auf Instagram, um zu erfahren, wann der nächste Blogpost veröffentlicht wird. 🙂
Du hast Fragen?
Bevor du in den Kommentaren Fragen stellst - checke unsere häufigen Fragen & Antworten, wo wir alle wichtigen Fragen rund um den MedAT bereits beantwortet haben.









